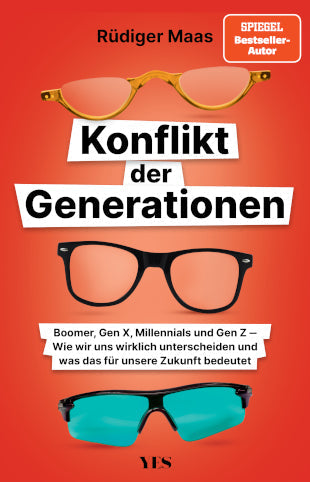
Rezension zu "Konflikt der Generationen"
Share
Rüdiger Maas – „Konflikt der Generationen. Boomer, Gen X, Millennials und Gen Z – wie wir uns wirklich unterscheiden und was das für unsere Zukunft bedeutet“
1. Auflage 2025, Yes Publishing
Warum ich dieses Buch gelesen habe
Als Trainerin bei QUBIC begleite ich Führungskräfte dabei, Diversität im Team aktiv zu gestalten. Das Thema „Generationen“ ist dabei omnipräsent – in Gesprächen über Führung, Zusammenarbeit und Personalgewinnung. Häufig begegnen mir dabei stereotype Zuschreibungen oder Unsicherheiten im Umgang mit altersgemischten Teams.
Ich war der Einteilung in Generationen von Anfang an kritisch gegenüber. Genau deshalb wollte ich wissen: Was ist eigentlich dran an diesen Kategorien – und was bleibt, wenn man tiefer blickt? Das Buch von Rüdiger Maas versprach einen differenzierten Zugang, denn schon im Vorwort weist der Autor darauf hin, dass es willkürlich ist, Menschen anhand ihres Geburtsjahrs in 15-Jahres-Kohorten einzuteilen. Dennoch sei es sinnvoll, gemeinsame Erfahrungshorizonte zu betrachten. Das weckte mein Interesse.
Inhalt und Ansatz
Maas beschreibt in seinem Buch fünf Generationen – von der Stillen Generation bis zur Generation Z – und analysiert, wie sie sich in Bezug auf Werte, Lebensentwürfe und Kommunikationsgewohnheiten unterscheiden.
Dabei skizziert er u. a.:
- Die Babyboomer als leistungsorientierte, statusbewusste und oft hierarchisch sozialisierte Generation mit hoher Pflichtorientierung.
- Die Generation Z als digital geprägte, feedbackhungrige und sicherheitsorientierte Gruppe, die nach Sinn, psychologischer Sicherheit und klarer Führung sucht.
Ein erhellender Aspekt: Maas macht verständlich, warum es heute zu mehr Reibung zwischen Generationen kommt – insbesondere durch technologische Umbrüche. Während frühere Generationen Wissen durch Erfahrung weitergaben, erleben wir heute oft ein Umkehren der Rollen: Die jüngeren sind technikaffiner, während ältere Kolleg*innen sich mit dem Tempo der Veränderungen schwertun. So beschreibt Maas etwa, dass die Oma keine Social-Media-Erfahrung aus ihrer Jugend mitbringt – und Jugendliche nicht mehr auf die Ausstrahlung ihrer Lieblingsserie warten müssen, sondern jederzeit streamen.
Gleichzeitig betont Maas:
"Die Aufgabe der Generationenforschung ist es herauszufinden, wie Menschen mit gemeinsamen Erfahrungshintergründen diese verarbeitet haben, was also die Menschen aus den Einflüssen gemacht haben, die auf sie einwirkten.“
Er nimmt die Generationenzuschreibungen also nicht als harte Fakten, sondern als soziale und kulturelle Annäherungen, die immer auch durch Unterschiede innerhalb der Gruppen gebrochen werden müssen:
„Wenn wir es schaffen, einzelne generationelle Merkmale für eine Alterskohorte herauszulösen, werden immer auch Unterschiede sichtbar.“
Was mir gefallen hat – und was nicht
Das Buch ist leicht zugänglich, verständlich geschrieben und mit vielen praktischen Beispielen angereichert – von Erlebnissen in der Beratung bis zu typischen Missverständnissen im Alltag.
Kritisch sehe ich allerdings, dass das Buch nicht durchgängig konsequent differenziert. Trotz berechtigter Kritik an Typisierungen arbeitet Maas selbst mit stark zugespitzten Personenbeschreibungen (z. B. „Thomas, der Boomer“, „Millennial Mandy“). Das macht das Buch anschaulich, aber verstärkt auch Schubladendenken, dem es eigentlich entgegenwirken möchte.
Fazit
Ein unterhaltsamer und zugänglicher Einstieg in das Thema Generationen in der Arbeitswelt. Für Menschen, die sich mit Führungs- und Teamkultur beschäftigen, bietet das Buch viele Denkanstöße – besonders zur Rolle von Technik, Sprache und Sozialisation.
Für eine strategische Auseinandersetzung mit Führung in altersgemischten Teams empfehle ich, weitere wissenschaftliche und praxisorientierte Quellen ergänzend heranzuziehen. Denn: Stereotypen zu erkennen ist wichtig – sie zu überwinden, ist Führungsarbeit.
Katharina Nolden
